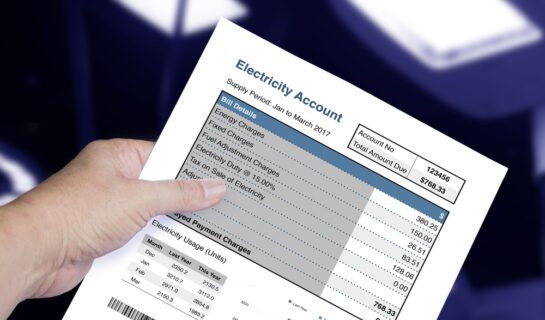LG Berlin, Az.: 53 S 332/07
Urteil vom 15.07.2008
Die Berufung der Klägerin gegen das am 02.10.2007 verkündete Urteil des Amtsgerichts Schöneberg – 3 C 14/07 – wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Gründe
Von der Darstellung des Tatbestands wird gem. §§ 540 Abs. 2, 313a Abs. 1 S. 1 ZPO, 26 Nr. 8 EGZPO abgesehen.
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden, §§ 511 ff. ZPO. Sie bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg, denn die angegriffene Entscheidung beruht nicht auf einem Rechtsfehler (§ 546 ZPO) und die nach § 529 zugrunde zu legenden Tatsachen rechtfertigen keine andere von der erstinstanzlichen abweichende Entscheidung.

Die Klägerin wendet sich mit ihrem Rechtsmittel nur insoweit gegen das angegriffene Urteil, als sie mit ihrem Antrag bezüglich eines Verbots von Grillen und Fußballspielen unterlegen ist.
Das Amtsgericht hat jedoch zu Recht das Vorliegen der Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs verneint.
Erforderlich sind insoweit Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr eines objektiv widerrechtlichen Eingriffs in ein geschütztes Recht oder Rechtsgut (vgl. Palandt-Sprau, 67. Aufl., Rdnr. 18 ff. vor § 823). Dies hat das Amtsgericht unter Hinweis auf die geringe Anzahl der von der Klägerin im Jahr 2006 angeführten Vorfälle verneint und insoweit eine sozial adäquate Nutzung angenommen. Dieser Wertung schließt sich die Kammer auch unter Berücksichtigung der im Berufungsverfahren für das Jahr 2008 vorgetragenen Vorfälle an.
Auch ein eingeschränktes Verbot des Grillens, was als Minus zum begehrten generellen Verbot in Betracht käme, scheidet damit aus.
Die Besonderheit der vorliegenden Situation mit einem fest installierten Holzkohlegrill mit größerer Dimension macht dabei nicht den entscheidenden Unterschied zum üblichen von den Nachbarn in bestimmten Grenzen zu duldenden familiären Grillen mit einem kleineren Grillgerät, so dass dieses jedenfalls einmal wöchentlich hinzunehmen ist. Im Gegenteil erlaubt der größere Grill die Zubereitung des Grillguts innerhalb kürzerer Zeit, was bei der Beköstigung von Gruppen durchaus von Bedeutung ist und den jeweiligen Zeitraum der Belästigung der Nachbarschaft reduziert.
Hinzu kommt, dass die Klägerin im Interesse der Allgemeinheit dazu gezwungen sein dürfte, in gewissem Maße andersartige und auch höhere Immissionen als Begleiterscheinungen kindlichen und jugendlichen Freizeitverhaltens hinzunehmen, als es sonst in reinen Wohngebieten der Fall ist (vgl. BGH NJW 1993, 1956, 1958 m. w. N.), jedenfalls solange dem nicht öffentlichrechtliche Vorschriften entgegenstehen.
Das Ausgeführte gilt auch hinsichtlich des beanstandeten Fußballspielens.
Ohnehin erscheint fraglich, ob dem Fußballspielen neben der bereits rechtskräftig entschiedenen Lärmbelästigung noch eine selbstständige Bedeutung zukommt. Spezifische Auswirkungen dieser Sportart, die sich nicht in Geräuschimmissionen äußern, hat die Klägerin nur insoweit angeführt, dass die sich bereits realisiert habende Gefahr besteht, dass ein Ball auf ihrer Terrasse landet. Dies ist aber bei fahrlässiger Verursachung als Einzelfall ebenfalls sozialadäquat und hinzunehmen, so dass eine widerrechtlicher Eingriff der Beklagten (!) nicht vorliegt.
Im Übrigen ist das vorgetragene „Kicken“ im Garten begrifflich schon schwer unter Fußballspielen zu subsumieren. Der vor der Terrasse der Klägerin belegene hintere Teil des Gartens ist weder als Fußballplatz ausgestaltet noch finden dort regelrechte Fußballspiele statt.
Nach alledem ist aber darauf hinzuweisen, dass die bestätigte Klageabweisung nicht einen Freibrief der Beklagten für uneingeschränkte Ballspiele und Grillfeste darstellt. Sobald die Grenze des Hinzunehmenden nach Anzahl und Intensität der Immissionen überschritten ist, wäre die Klägerin rechtlich in der Lage, erneut und dann erfolgreich auch insoweit Unterlassung zu verlangen.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10 und 713 ZPO.